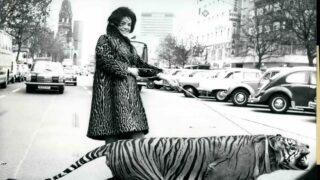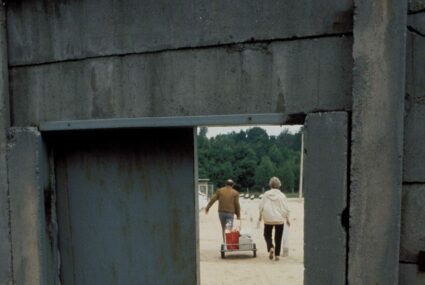Stadtentwicklung
Eine Bibliothek für die Friedrichstraße: Leerstand, Luxus und Visionen

Stefanie Giesinger: „Kaugummi ist mein Moment zum Durchatmen“

Kommentar
Ist der „Thaipark“ tot?

Stadtleben
EXPO 2035 Berlin: Hier lest ihr das Heft zur Weltausstellung